Praxiswissen Arbeitsrecht A-Z
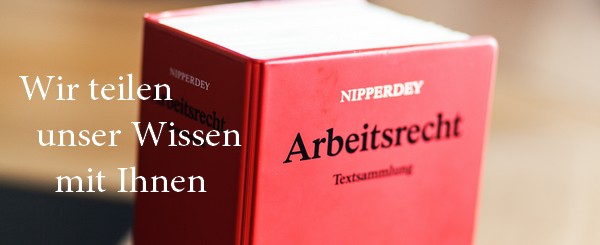
Kündigungsfrist
Was versteht man unter einer Kündigungsfrist?
Rechtslage zur Kündigungsfrist
Die Kündigungsfrist für die ordentliche und fristgerechte Kündigung kann gesetzlich, durch Tarifvertrag oder einzelvertraglich geregelt sein. Ausgangspunkt für die Ermittlung der zutreffenden Kündigungsfrist ist dabei stets die gesetzliche Regelung, insoweit wird gesetzlich auch geregelt, ob und inwieweit Abweichungen von den gesetzlichen Bestimmungen durch Tarifverträge bzw. einzelvertragliche Bestimmungen zulässig sind. Die gesetzliche Kündigungsfrist ist im Arbeitsrecht im § 622 BGB geregelt; diese gesetzliche Kündigungsfrist gilt einheitlich für Arbeiter und Angestellte. Danach gelten im Arbeitsrecht folgende Kündigungsfristen:
- die sogenannte Grundkündigungsfrist gemäß § 622 Abs. 1 BGB beträgt vier Wochen zum 15. des Monats oder zum Monatsende;
- die verlängerten Kündigungsfristen gemäß § 622 Abs. 2 BGB gelten für Arbeitgeber ausgehend von der Betriebszugehörigkeit des Arbeitnehmers und zwar je nach Dauer der Betriebszugehörigkeit zwischen einem und sieben Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermonats.
Die längere gesetzliche Kündigungsfrist
Je länger das Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen Bestand hatte, desto länger sind gemäß § 622 Abs. 2 BGB auch die gesetzlichen Kündigungsfristen für den Arbeitgeber. Folgendermaßen verlängert sich die Kündigungsfrist für den Arbeitgeber:
- nach 2 Jahren Betriebszugehörigkeit verlängert sich die Kündigungsfrist auf einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
- nach 5 Jahren Betriebszugehörigkeit verlängert sich die Kündigungsfrist auf zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
- nach 8 Jahren Betriebszugehörigkeit verlängert sich die Kündigungsfrist auf drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
- nach 10 Jahren Betriebszugehörigkeit verlängert sich die Kündigungsfrist auf vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
- nach 12 Jahren Betriebszugehörigkeit verlängert sich die Kündigungsfrist auf fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
- nach 15 Jahren Betriebszugehörigkeit verlängert sich die Kündigungsfrist auf sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
- nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit verlängert sich die Kündigungsfrist auf sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats.
Für die Probezeit sieht der Gesetzgeber im § 622 Absatz 3 BGB eine Kündigungsfrist von zwei Wochen (zu jedem beliebigen Endtermin) vor. Die Probezeit darf sechs Monate aber nicht überschreiten.
Wann kann eine abweichende Kündigungsfrist gelten?
In Tarifverträgen ist es grundsätzlich möglich, kürzere Kündigungsfristen als die gesetzlich vorgeschriebenen zu vereinbaren. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags besteht zudem die Möglichkeit, die abweichenden Bestimmungen zur Kündigungsfrist gemäß den Tarifverträgen auch zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch Bezugnahme auf den Tarifvertrag zu vereinbaren.
In Einzelarbeitsverträgen sind gemäß § 622 Abs. 4 BGB Abweichungen von der gesetzlichen Kündigungsfrist in Form der Verkürzung der Kündigungsfrist nur ausnahmsweise und auch nur bezogen auf die Grundkündigungsfrist des § 622 Abs. 1 BGB zulässig. Abweichende kürzere Kündigungsfristen können in dem Fall vereinbart werden, wenn der betreffende Arbeitnehmer nur vorübergehend als Aushilfe eingestellt wurde; die maximale Zeitspanne der Aushilfstätigkeit darf hierbei 3 Monate nicht überschreiten. Auch in Kleinbetrieben, wenn der Arbeitgeber nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ohne Auszubildende beschäftigt und die Kündigungsfrist noch mindestens vier Wochen beträgt, können einzelvertraglich kürzere Kündigungsfristen vereinbart werden. Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, die wöchentlich nicht mehr als 20 Stunden arbeiten, werden bei der Feststellung der beschäftigten Angestellten mit 0,5 angerechnet. Teilzeitbeschäftigte, die regelmäßig mehr als 20, aber nicht mehr als 30 Stunden arbeiten, werden hier mit 0,75 angerechnet. Die Kleinbetriebsregelung, da eine Kündigungsfrist von 4 Wochen nicht unterschritten werden darf, beschränkt sich damit allein auf den Wegfall des Kündigungstermins und ist kaum praxisrelevant. Von den verlängerten Kündigungsfristen gemäß § 622 Abs. 2 BGB kann einzelvertraglich nicht abgewichen werden.
Nach dem Prinzip der Vertragsfreiheit und dem arbeitsrechtlichen Günstigkeitsprinzip steht es Vertragsparteien jedoch frei, in einem Arbeitsvertrag eine längere Kündigungsfrist als vom Gesetz vorgesehen festzulegen, da die längere Kündigungsfrist als eine Abweichung zu Gunsten des Arbeitnehmers angesehen wird. Mit Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 26.10.2017 (Az. 6 AZR 158/16) hat dieses allerdings festgestellt, dass eine dreijährige Kündigungsfrist die Vertragsparteien unzumutbar lange bindet. Eine Kündigungsfrist, die vertraglich für den Arbeitnehmer eine längere Frist vorsieht als für den Arbeitgeber, ist grundsätzlich nicht erlaubt und gilt als unzulässig.



